Suche
Lesesoftware
Info / Kontakt
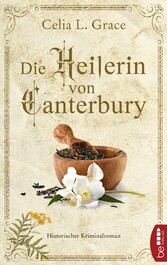
Die Heilerin von Canterbury - Historischer Kriminalroman
von: Celia L. Grace
beTHRILLED, 2021
ISBN: 9783751707305 , 234 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 4,99 EUR
eBook anfordern 
Prolog
Hexenmeister und Zauberer kündeten eine Zeit des Mordens an. Die Schreiber unter den Mönchen hockten in ihren feuchten Zellen, tunkten Federkiele in Tintenfässer aus Horn und schrieben die Chronik ihrer Zeit nieder, in der sie fein säuberlich alle Verbrechen verzeichneten: Mord und Totschlag, Treuebruch und Landesverrat. Die guten Mönche glaubten in der Tat, das Böse würde obsiegen. Gerüchten zufolge habe schließlich der Geisterbeschwörer John Marshall am Vorabend zu Allerheiligen sieben Pfund Wachs und zwei Ellen Tuch zu einem verlassenen Herrenhaus außerhalb von Maidstone getragen und dort grobe Puppen angefertigt, die den König, die Königin und alle großen Adligen des Landes darstellten. Marshall habe sie alle in Blut getränkt, mit Dolchen zerstochen und über einem lodernden Feuer geröstet. Tief in den Wäldern außerhalb Canterburys warfen sich andere Zauberer lange Tierfelle mit riesigen Schwänzen über; sie schwärzten ihre Gesichter und riefen Herodias, die Königin der Hexen, um Hilfe an. Wieder andere Hexenmeister, so schreiben die Chronisten, brachten der Königin der Nacht Blutopfer und beschworen die Ghouls. Seltsame Dinge wurden beobachtet: Scharen von Hexen flogen in dunkler Nacht durch die Lüfte und führten stumme Leichenkolonnen zu Teufelsmessen.
Gerüchte dieser Art drangen sogar nach Canterbury. Ein Mann mit einem Totenschädel und einem Buch voller Zauberformeln wurde beim Westtor festgenommen, und jenseits der Stadtgrenzen fuhr man einer Frau, die ihren Mann umgebracht hatte, mit Peitschenhieben über den Mund und schlug ihr eine Eisenspitze in den Kopf; doch als sie begraben war, zuckte ihre sterbliche Hülle noch immer. Das Frühjahr wich allmählich dem Sommer, und damit stellten sich weitere Übel ein. Das teuflische Schweißfieber brach aus, dessen Opfer schon nach wenigen Stunden starben: ob im Schlafen, im Gehen, ob beim Fasten oder Essen. Die Krankheit begann immer mit Schmerzen im Kopf, die dann auf das Herz übergriffen; ein Heilmittel gab es nicht. Alle möglichen Arzneien waren ausprobiert worden: das Horn eines Einhorns, Drachenwasser und Engelwurz. Man sprach Gebete, brachte Reliquien herbei, flehte den Himmel um Hilfe an, aber der Tod schritt unbeirrt durch die stinkenden, engen Gassen und Straßen von Canterbury. Auf der Jagd nach Opfern blickte sein Totenschädel gierig grinsend durch die Fenster, seine knochigen Finger klopften an Türen oder klapperten mit den Fensterflügeln.
Dann endlich kam der Sommer. Das Schweißfieber verschwand, nicht aber Gewalt und Blutrausch. Man hörte, dass Menschen auf merkwürdige Art gestorben waren, von mysteriösen Todesfällen unter denjenigen, die in Scharen nach Canterbury zogen, um die Hilfe des Heiligen Thomas Becket zu erflehen, dessen zerschlagener Leichnam mit gespaltenem Schädel unter Goldplatten vor dem Hochaltar der Kathedrale von Canterbury lag. Natürlich ignorierten die Lebenden die Toten, und zunächst blieben die Morde unbeachtet. Immerhin war es Sommer geworden. Die Straßen waren trocken, das Gras stand hoch und saftig, das Wasser war süß und frisch. Eine Zeit für Reisen und Besuche bei Freunden. Man traf sich unter Obstbäumen, schlürfte kühlen Wein oder leerte Krüge des während der Wintermonate selbstgebrauten Ales. Man sprach über die blutrünstigen Prophezeiungen, die Fehler der Höherstehenden und vor allem über den erbitterten Bürgerkrieg, der zwischen den Häusern York und Lancaster tobte.
Im Westen saß die Wolfskönigin Margarete von Anjou mit ihren Generälen zusammen und heckte Pläne aus, wie sie den Thron für ihren geisteskranken Mann, König Heinrich VI, und für ihren Sohn, ihren Goldjungen Edward, an sich reißen könnte. Von ihren Feinden wurde sie verspottet. Es hieß, ihr Mann sei so heilig, er habe weder den Verstand noch die Mittel, einen Erben zu zeugen, und der junge Prinz sei ein Spross ihrer heimlichen Liebe zu Beaufort, Herzog von Somerset. In London traf sich Edward aus dem Hause York mit seiner silberhaarigen Gemahlin Elizabeth Woodville und seinen kriegshungrigen Brüdern Clarence und Gloucester im Geheimkabinett des Königs in Westminster und schmiedete raffinierte Pläne gegen die Absichten der Wölfin. Sie besuchten dreimal täglich die Messe, sangen Frühmette und Vesper und hatten dabei nichts anderes im Sinn, als Margarete, ihren Mann und das gesamte Haus Lancaster zu vernichten. Wahrlich, es war eine Zeit des Mordens, und denjenigen, die sich daran erinnern konnten, fielen die düsteren Zeilen Chaucers ein, in denen es hieß:
Der lächelnde Schurke, das Messer im Mantel versteckt; Brennende Scheunen, das Haus von Ruß schwarz bedeckt. Verrat und Leichen, im Bett ermordet gefunden, Der offene Kampf, die blutenden Wunden.
Ein paar Wochen später saß Robert Clerkenwell, ein Arzt aus Aldgate in London, unweit der Lagerhäuser im Zentrum von Canterbury in der Schenke »Zum Schachbrett« und schwafelte eifrig über die Vorteile eines solchen Krieges. Robert war reich; das Heilmittel, das er während des Schweißfiebers verkauft hatte, Rosenwasser mit Honig, hatte den meisten seiner Patienten zwar kaum geholfen, aber es hatte dem guten Arzt eine Börse voll klingender Gold- und Silbermünzen eingebracht. Robert blickte zufrieden auf ein erfolgreiches Jahr zurück.
»Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen«, pflegte er fromm vor sich hin zu murmeln, wenn er seinen Lohn einstrich und seine Patienten dem sicheren Tod überließ.
Nachdem es nun Sommer geworden war, hatte Robert beschlossen, einen angenehmen Ritt nach Canterbury zu unternehmen, um an Beckets Grab Gott dem Herrn für seine Gnade zu danken. Die Reise war ohne Zwischenfälle verlaufen, er hatte die Ruhe der lieblichen Landschaft genossen. Es war, als hielte das Land den Atem an, während Könige und Prinzen sich auf den Kampf vorbereiteten. Clerkenwell war seit drei Tagen in Canterbury; zweimal war er in der Kathedrale gewesen, hatte in den Garküchen und Schenken der Stadt gut gegessen, hatte sogar für die Dienste einer hübschen Dirne bezahlt, die ihm oben, in der geräumigsten Kammer der Taverne, ganz nach seinen Wünschen gefällig war. Morgen würde er abreisen; seine Reisetaschen waren gepackt, und der gute Arzt hatte gerade seine letzte Mahlzeit in Canterbury zu sich genommen, seine letzte Mahlzeit überhaupt: eine saftige, goldbraun gebratene Wachtel, die auf der Zunge zerging, frisches Gemüse und klaren Weißwein, der in den geräumigen Kellern des Wirtshauses gekühlt wurde. Jetzt lehnte sich Robert zurück, rülpste leicht und strahlte seine Tischgenossen an, die rechts und links von ihm im Schankraum saßen.
»Ihr werdet noch an meine Worte denken«, sagte er, kniff die verwegenen Lippen zusammen und tätschelte sich den umfangreichen Bauch. »Königin Margarete wird siegen: Sie hat starke Bretonen im Gefolge, und Somerset und Wenlock sind fähige Generäle. Edward von York wird es schwer haben, wenn er behalten will, was er sich genommen hat.«
Clerkenwell stierte mit seinen wasserblauen Augen in die Runde, aber die anderen Pilger waren wohl zu müde oder zu betrunken und reagierten nicht auf seine Worte. Hinzu kam, dass ihr Tischgenosse, der Arzt, knauserig war. Sie alle hatten gehofft, dass er noch vor Ende des Abends den Wirt bitten würde, ein neues Weinfass anzuzapfen oder zumindest noch mehr Fleischplatten oder Früchte zu bringen, die er mit seinen immer noch hungrigen und weniger begüterten Tischgenossen teilen würde. Der Arzt schmatzte laut und schaute sich um. Er nahm seinen Becher, schwenkte umständlich die Hefe, die sich auf dem Grund abgesetzt hatte, und leerte ihn in einem Zug. Mit starrem Blick beugte er sich nach vorn.
»Mehr Wein! In drei Teufels Namen! Wo steckt denn dieser Bursche?«
Ein Diener mit von Essensresten und Weinflecken übersäter Schürze eilte herbei. Die verfilzten Haare hingen ihm ins Gesicht, so dass man ihn nicht erkennen konnte.
»Du bist nicht der Kerl, der mich beim letzten Mal bedient hat!«, schrie der Arzt ihn an. »Teufel noch eins, ich will mehr Wein!«
Der Diener nickte, nahm den Becher und eilte davon. Kurz darauf kehrte er mit dem randvollen, überschwappenden Kelch zurück und stellte ihn vorsichtig vor dem Arzt auf den Tisch. Die anderen Pilger warfen sich vielsagende Blicke zu, und einige wurden unruhig. Allem Anschein nach würde der Arzt sich nicht als ihr Wohltäter erweisen. Robert schlürfte den Weißwein und genoss das kühle Nass auf der Zunge und im Rachen. Er nahm noch einen Schluck, leckte sich die Lippen, nicht ahnend, dass jetzt ein tödliches Gift in seinen Bauch drang, das wie ein Pfeil auf sein Herz und seinen Verstand zielte. Der Arzt stutzte; er fühlte sich unwohl, sein Magen verkrampfte sich, sein Herz begann zu flattern, sein Atem kam in kurzen Stößen. Er stand auf, riss verzweifelt an seinem Kragen. Sein ganzer Körper schmerzte nun, als würden unsichtbare Flammen an ihm lecken. Die anderen Pilger sahen mit unverhohlenem Entsetzen und offenen Mündern zu, wie diesem redseligen Arzt die Augen aus dem Kopf traten, wie sein Gesicht hellrot anlief, wie er nach Luft schnappte, würgte und um sein Leben rang, bevor er tot...




