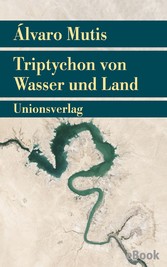Suche
Lesesoftware
Info / Kontakt
Triptychon von Wasser und Land - Roman. Die Abenteuer und Irrfahrten des Gaviero Maqroll
von: Álvaro Mutis
Unionsverlag, 2019
ISBN: 9783293310698 , 192 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 8,99 EUR
eBook anfordern 
Mehr zum Inhalt

Triptychon von Wasser und Land - Roman. Die Abenteuer und Irrfahrten des Gaviero Maqroll
Treffen in Bergen
Günlük işlerdenmiş gibi ölüm.
[Als wäre der Tod etwas Alltägliches.]
Ilhan Berk
Dass mir das gerade in Brighton passieren musste, hätte jeder, der das populäre Seebad in Sussex kennt, für natürlich und vorhersehbar gehalten. Brighton, dieser Ort, wo die Londoner mitten in einer düsteren Ansammlung viktorianischer und edwardianischer Bauten, die alle Fieberfantasien übertreffen, unbeirrt das Meer genießen; der Ort, wo es selbst das bescheidenste aller Pubs fertig bringt, uns genau den Whisky vorzusetzen, den wir nicht wollten, und wo uns die Frauen in den Straßen und auf der trostlosen Mole, an die das eisig-graue Meer brandet, eine lange Liste von Zärtlichkeiten feilhalten, die in der Stunde der Wahrheit zur homöopathisch beschleunigten Version dessen werden, was ein Anglikaner unter Lust versteht; kurzum, in Brighton, wo wir eigentlich schon bei der Ankunft wissen, dass wir hier nichts verloren haben, in Brighton also musste ich in einer schäbigen Pension drei Tage das Bett hüten. Bei all dem Durchfall und Ekel hätte ich beinahe den Geist aufgegeben.
Ich war hergekommen, um mich mit Sverre Jensen zu treffen, meinem alten Freund und Partner auf den Fischzügen in Alaska und vor der Küste Britisch-Kolumbiens. Er wiederum war hier mit einem Reeder verabredet, der wegen eines schweren Herzleidens in den Ruhestand getreten war und uns ab und zu beim Chartern eines Fischkutters für unsere Arbeit entgegenkam. In dem Moment, als ich in London den Zug bestieg, wurde mir klar, dass einige Bissen des Seeigelgerichts, das ich kurz zuvor in einem thailändischen Restaurant unweit des Strand verzehrt hatte, ihre Frische zu einem guten Teil eingebüßt haben mussten. In meiner Ungewissheit bestellte ich als kaum sehr probates Gegengift eine Flasche portugiesischen Weißwein, der sich als ebenso dubios erwies wie die Seeigel. Die ersten Krämpfe machten sich noch vor der Ankunft in Brighton bemerkbar. Ich ermannte mich und ging zum Haus unseres Reeders, doch auf mein Klingeln antwortete niemand. Das Haus schien verlassen zu sein. Sämtliche Gelenke schmerzten mich, und mein Kopf war zu einer Art Glocke geworden, wo in unerbittlichem Rhythmus Hammerschläge dröhnten, die mich beinahe blendeten und mir den Atem benahmen. Ein Taxi brachte mich zu der Pension, die mir Jensen empfohlen hatte. Sie lag in einem dunklen Gässchen mit dem wenig ermutigenden Namen Monkeyhead Lane. Die Besitzerin, eine füllige Italienerin mit einem Schatten von beginnendem Schnurrbart, legte mir das Anmeldeformular zum Ausfüllen vor und gab mir dann den Schlüssel zu einem Zimmer im vierten Stock des Hauses. Jede Stufe wurde mir zur nicht enden wollenden Qual. Kurz darauf brachte mir die Matrone einen bitteren Aufguss mit dem schillernden Glanz eines Öls herauf, das ich nicht zu identifizieren versuchte. Die Autorität der Frau, der ich bereits von meiner Vergiftung mit den Londoner Seeigeln erzählt hatte, ließ keine Widerrede zu, sodass ich das Gesöff schluckte, so gut ich eben konnte. Die Behandlung dauerte drei Tage, in denen ich die teuflische Medizin als einzige Nahrung zu mir nahm. Als ich wieder aufstehen und ein wenig herumgehen konnte, war ich bereits geheilt, fühlte mich indessen wie ein Neunzigjähriger, der die letzten Monate seines Lebens noch zu nutzen versucht.
In Brighton kannte ich niemanden. Vor Jahren waren wir in einer dieser Ilona-Anwandlungen, die sie ›l’appel de mon sang slave‹ zu nennen pflegte, in Brighton gelandet, um hier einige Sommerwochen zu verbringen. Ich weiß nicht, welche Vorstellung sich meine früh verstorbene Freundin von den Wundern dieses Orts gemacht hatte – jedenfalls beschlossen wir, nachdem wir uns zwei Wochen lang in einem unerträglich nach englischer Küche stinkenden Zimmer geliebt hatten, nach Triest zu fahren und uns bei einer Kusine von Ilona einzuquartieren, die uns empfing, als kämen wir eben vom unwirtlichsten Ort der Erde. Als ich unserer Gastgeberin von dem Gestank erzählte, dem unser Brightoner Zimmer ausgesetzt gewesen war, bemerkte Ilona: »Das mit der englischen Küche ist eine Behauptung des Gaviero. Dort roch es nach dem, was die Pikten aßen, und vermutlich haben ihre Nachfahren keine großen Fortschritte gemacht.«
Das war meine einzige Erinnerung an das berühmte englische Seebad und auch meine einzige, keineswegs angenehme Erfahrung dort.
Als ich noch am ganzen Körper das Gefühl hatte, gnadenlos zusammengeschlagen worden zu sein, beschloss ich, zu dem walisischen Reeder zurückzugehen, der auf den Namen Glanmor Conway hörte. Diesmal öffnete mir ein einstudiert schüchtern aussehendes junges Mädchen, eine der typischen Engländerinnen mit durchsichtiger Haut und von etwas kraftloser Erscheinung, die in ihrem Innern jedoch über eine grenzenlose Energie und das vollständigste Arsenal von Listen verfügen, um sich im Leben durchzuschlagen. All das, ich wiederhole es, geschützt durch einen naiven Ausdruck, der denjenigen leicht täuscht, der mit dieser Spezies nicht vertraut ist. Ich nannte ihr meinen Namen und erklärte dann, ich hätte eine Verabredung mit Mister Conway. Das junge Mädchen bat mich herein und führte mich in einen Raum, der das Büro des Hausherrn sein musste. Sie deutete auf einen Stuhl und bat mich, Platz zu nehmen, während sie sich in dem Sessel niederließ, der hinter dem Schreibtisch stand und offensichtlich zum ausschließlichen Gebrauch des Reeders bestimmt war. Ich musste angesichts der mir seltsam erscheinenden Dreistigkeit ein überraschtes Gesicht machen, denn Cathy – so hatte sie sich mir vorgestellt, als ich ihr meinen Namen nannte – erklärte, während sie mit ihren kaum wahrnehmbar blauen Augen in eine den geborenen Simulanten eigene Ferne starrte: »Glanmor ist ein Onkel zweiten Grades meiner Mutter, und nach ihrem Tod brachte er mich hierher, damit ich bei ihm leben konnte. Ich habe keine weiteren Angehörigen. Mein Vater ist beim Schiffbruch der Lady Ann umgekommen, an den Sie sich sicherlich erinnern.«
Dunkel entsann ich mich noch des Untergangs dieses alten Trampschiffs, das Conway gehört und Schiffbruch erlitten hatte, als es bei der Einfahrt in den Hafen des dänischen Århus auf eine Mine auffuhr. Das war, nebenbei bemerkt, fast zwanzig Jahre her.
Dann teilte mir Cathy mit, die Anweisung, die sie von Glanmor habe, sei die, sowohl Sverre Jensen als auch mich bis zu seiner Rückkehr in seinem Haus aufzunehmen. Er habe einige Tage wegfahren müssen, um in Bristol eine geschäftliche Angelegenheit zu regeln. Ich kannte Conway von früher, und trotz seiner sprichwörtlichen Herzlichkeit erschien mir das Angebot, in seinem Haus zu wohnen, etwas ungewöhnlich. Aber ich beschloss, es anzunehmen, denn meine Mittel waren ziemlich erschöpft, und die Italienerin mit dem Damenbart wirkte nicht wie jemand, der Verzüge bei der Bezahlung der Zimmermiete langmütig hinnahm. Ich fragte Cathy, ob sie etwas von meinem norwegischen Freund gehört habe, und sie verneinte, doch Glanmor habe ihr gesagt, er werde etwa gleichzeitig mit mir eintreffen. Ich erklärte ihr, ich nähme die Einladung ihres Onkels gerne an und sei in Kürze mit meinen Siebensachen zurück. Sie lächelte halb sittsam, halb verschlagen, was mich mit einer unbestimmten Unruhe erfüllte.
Als ich, meinen Seesack über der Schulter, von der Pension zurückkam, führte mich Cathy in eine Mansarde, zu der man über einige steile Stiegen gelangte, die mich außer Atem brachten. Wir betraten ein geräumiges Zimmer mit zwei Betten, jedes unter einem Dachfenster, einem großen Schrank und einem Haufen Ferngläser, Kompasse und unmöglich zu bestimmender nautischer Gegenstände, die einem bei jedem Schritt im Weg standen. Das Badezimmer befand sich am Ende des schmalen Korridors, der den ganzen Dachboden durchmaß. Cathy zeigte mir ebenfalls ihr Schlafzimmer, das neben dem Bad lag. Sie tat dies ohne besonderen Ausdruck, als handle es sich um eine Routineinformation. Dass die Nichte zuoberst im Haus wohnte und gleichzeitig den Schreibtischsessel ihres Onkels benutzte, um sich mit Unbekannten zu unterhalten, konnte ich im ersten Augenblick nicht in Einklang bringen. Ich ging wieder in meine Mansarde, legte die drei, vier Bücher, die ich immer bei mir habe, auf den Nachttisch und verwahrte den Sack mit den Kleidern in dem großen Schrank, der ächzte wie ein müdes Tier. Cathy verschwand wortlos, und ich hörte sie auch nicht die Treppe hinuntergehen. Nun war mir klar, warum mir beim ersten Mal niemand geöffnet hatte. Das junge Mädchen musste in ihrem Zimmer gewesen sein, und dort hörte man die Türklingel sicher nicht. Alles erschien mir ungewöhnlich, aber da ich wusste, dass uns bei Engländern nichts überraschen darf, beschloss ich, mich aufs Bett zu legen und eine Weile auszuruhen. Die Strapazen des Umzugs hatten mich erschöpft, und es zeigte sich, dass die Rekonvaleszenz nach meiner Vergiftung länger dauerte als vorausgesehen.
Den restlichen Tag verbrachte ich in meinem Zimmer. Zweimal kam Cathy mit einer Tasse Tee und Toasts herauf. Das war das Einzige, was ich schlucken konnte, ohne dass die Übelkeit zurückkam, die nur langsam verschwinden wollte. So bekam ich einige Einblicke in Glanmor Conways Leben, nicht alle erbaulich übrigens und einige eher düster. Als Cathy zu ihrem entfernten Verwandten kam, war sie noch nicht einmal ein Teenager. Conway beschäftigte sie als Dienstmädchen für einfache Verrichtungen, die eine alte Magd aus Wales überwachte, welche kaum Englisch sprach. Als Cathy zur Frau heranwuchs, schickte der Mann die Alte in ihr in den...