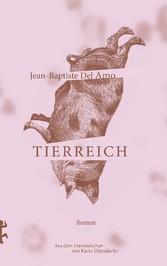Suche
Lesesoftware
Info / Kontakt
Tierreich
von: Jean-Baptiste Del Amo
Matthes & Seitz Berlin Verlag, 2019
ISBN: 9783957577382 , 440 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 21,99 EUR
eBook anfordern 
Kaum dass der Frühling sich zeigt und bis spät in den Herbst hinein setzt er sich abends auf die kleine Bank aus genageltem und wurmstichigem Holz, mit der abschüssigen Sitzfläche, unter dem Fenster, dessen Rahmen in der Nacht ein kleines Schattenspiel auf der Steinfassade auslöst. Drinnen auf dem Tisch aus massiver Eiche hechelt eine Öllampe, und das ewig knisternde Feuer im Kamin wirft auf die mit Salpeter überzogenen Wände den geschäftigen Schattenriss der Ehefrau, schwingt ihn hinauf zu den Deckenbalken oder bricht ihn in einer Zimmerecke, und dieses gelbe, flackernde Licht bläht den großen Raum auf, durchbricht dann die Dunkelheit des Hofes und zeichnet den Vater im Umriss, bewegungslos und schwarz, in einer Art Gegenlicht. Im Wechsel der Jahreszeiten erwartet er die Nacht auf dieser Holzbank, derselben, auf der er bereits seinen Vater vor ihm hat sitzen sehen und deren moosbewachsene und mit den Jahren morsch gewordene Füße immer mehr nachgeben. Wenn er dort sitzt, ragen die Knie bis hinauf an seinen Bauch, sodass er Schwierigkeiten hat, wieder hochzukommen, dennoch hat er nie daran gedacht, die Bank durch eine neue zu ersetzen, und bliebe von ihr auch nur ein letztes heiles Brett am Boden. Er glaubt, dass die Dinge so lange wie möglich so bleiben sollten, wie er sie immer gekannt hat, so wie andere vor ihm sie als gut erachtet haben oder so wie ihr Gebrauch sie eben hat werden lassen.
Wenn er vom Feld zurückkommt, zieht er sich gegen den Türpfosten gestützt die Schuhe aus, kratzt den Dreck sorgfältig von den Sohlen, bleibt auf der Zimmerschwelle stehen, wo er die feuchte Luft einsaugt, den Atem der Tiere, die strengen Dünste von Ragout und Suppe, von denen die Fenster beschlagen sind, so wie er einst als Kind stehen geblieben war und wartete, bis seine Mutter ihm bedeutete, er solle sich an den Tisch setzen, oder sein Vater zu ihm kam und ihn mit einem kleinen Stoß gegen die Schulter zur Eile antrieb. Sein langer und magerer Körper ist nach vorne gebeugt und weist am Nackenansatz eine skurrile Wölbung auf. Sein Hals ist so sonnengegerbt, dass er selbst im Winter nicht heller wird und für immer von einem geräucherten, dreckigen Leder umhüllt und wie gebrochen wirkt. Ähnlich einer Knochenzyste steht der erste Wirbel zwischen den Schultern hervor. Er nimmt den ausgebeulten Hut ab, der seinen schon kahlen, von der Sonne fleckigen Schädel bedeckt, hält ihn einen Augenblick lang in den Händen, als versuchte er, sich der Geste zu erinnern, die er nun ausführen soll, oder als hoffte er noch immer auf die Anweisung jener Mutter, die schon lange tot ist, von der Erde verschlungen und verdaut. Angesichts des beharrlichen Schweigens der Ehefrau entschließt er sich am Ende doch weiterzugehen, eingehüllt in den eigenen Gestank und den Gestank des Viehs, hin zum Schrankbett, dessen Tür er öffnet. Er setzt sich auf den Matratzenrand oder stützt sich erneut an der geschnitzten Holztür ab und knöpft zwischen zwei Hustenanfällen sein verklebtes Hemd auf. Am Ende des Tages ist ihm nicht nur das Gewicht seines Körpers unerträglich, von dem die Krankheit indes gewissenhaft alles Fett und Fleisch abgenagt hat, sondern allein schon das Aufgerichtetsein, und es scheint, als drohe er jeden Augenblick umzufallen, auf den Boden hinabzusegeln wie ein welkes Blatt, dabei zunächst die stickige Luft des Zimmers fegend, von rechts nach links und von links nach rechts, um sich dann einfach auf dem Boden abzulegen oder unter das Bett zu gleiten.
Auf dem Feuer, in einem gusseisernen Kessel, ist das Wasser inzwischen erhitzt worden, und die Erzeugerin reicht Éléonore den Krug mit kaltem Wasser. Das Mädchen macht nur kleine Schritte, denn es fürchtet, das Gefäß zum Überlaufen zu bringen, aus dem trotz aller Vorsicht Wassertropfen erst die Hände, dann die Unterarme entlanglaufen und die hochgekrempelten Ärmel ihrer Bluse durchnässen, während sie feierlich auf den Vater zugeht. Sie spürt, wie ihr Nacken unter dem vorwurfsvollen Blick der Erzeugerin zittert, die dicht hinter ihr ist und droht, sie mit dem kochend heißen Wasser aus der Schüssel zu übergießen, wenn sie sich nicht beeilt. Im Halbdunkel gelandet wie ein großer Vogel, die Ellbogen auf den Knien, die Arme und Hände schlaff vor sich baumelnd, ist der Vater in die Betrachtung der Holzmaserung des Schranks versunken oder in die des auf dem Waschtisch brennenden Dochts, der gegen die Dunkelheit ankämpft. Das spärliche Licht der Flamme reflektiert sich im Oval des an die Wand genagelten Spiegels und lässt vom Zimmer kaum mehr als ein Zerrbild übrig. Durch eine Öffnung in der Lehmmauer, auf Hüfthöhe, stecken zwei Kühe ihre Köpfe und wiederkäuenden Mäuler. Der Dunst ihrer trägen Körper und der Exkremente, die sie unter sich lassen, wärmt die Menschen. In ihren bläulichen Pupillen spiegeln sich die kleinen Szenen, die diese beim Feuerschein des Kamins darbieten. Der Anblick der Ehefrau und des Kindes scheint den Vater aus seiner nebelhaften Träumerei zu reißen und zurück in diesen schmächtigen, von Venen durchzogenen Körper zu führen. Wie gegen seinen Willen findet er die Kraft, sich wieder zu bewegen. Er rappelt sich von seinem kläglichen Lager hoch, zeigt den bleichen Rücken, richtet den mit grauem Flaum bedeckten Oberkörper wieder auf, in den Furchen von Rippen und Schlüsselbeinen gefangen wie das Tollkorn im Getreide. Der Bauch ist eingefallen, gelbgefärbt vom Kerzenlicht. Er lockert die Arme mit den schwieligen Ellbogen und deutet manchmal sogar ein Lächeln an.
Die Erzeugerin schüttet das heiße Wasser in die auf den Waschtisch gestellte Wanne. Sie nimmt den Krug aus Éléonores Händen, stellt ihn auf die Ablage, ehe sie zurück in ihre Küche geht, ohne den Vater eines Blicks zu würdigen, bemüht, ihren Augen das Bild des Mannes mit dem nackten und dürren Oberkörper zu ersparen, der ebenso abgemagert ist wie der direkt an die Wand am Fußende des Bettes genagelte Jesus Christus. Oben vom Kreuz herab wacht Er über ihren Schlaf und erscheint ihr in ihren späten und schläfrigen Gebeten, lediglich angekündigt durch einen Lichtstrahl des Mondes oder den hüstelnden Rest einer Kerze, deren Schein sich durch den Türspalt des Schrankbetts einschleicht, ein zu Tode gekreuzigtes Abbild des neben ihr eingeschlafenen Vaters, von dem sie inzwischen sorgsam Abstand hält, weil sie seine Nachtschweiße, seine spitzen Knochen, seinen pfeifenden Atem nicht mehr ertragen kann. Aber es kommt vor, dass sie, wenn sie sich von diesem Mann abwendet, der sie geheiratet und geschwängert hat, das Gefühl überfällt, sie verrate dadurch ihren Glauben und sie wende sich vom Sohn, ja von Gott selbst ab. Von diesem Schuldgefühl getrieben, wirft sie ihm, dem Ehemann, also einen raschen Blick zu, eine schroffe und harte Geste des Mitgefühls, und steht wieder auf, um die Wanne mit dem blutigen Auswurf, den er die ganze Nacht über aushustet, zu leeren, ihm einen Senfwickel zu bereiten oder einen Thymiantee mit Honig und Schnaps, den er, an den Kopfteil des Bettes gelehnt, von seinen Kopfkissen gestützt, in kleinen Schlucken hinunterschlürft, beinahe gerührt von dieser Fürsorge und sorgsam bedacht, nicht zu schnell zu trinken, um ihr seine Dankbarkeit zu zeigen, so als ob er diese bitteren und unwirksamen Abkochungen genösse, während sie von einem Bein aufs andere tritt. Denn schon hat sich das Bild des Vaters am Kreuz verflüchtigt, mit ihm auch das Schuldgefühl, und jetzt will sie so schnell wie möglich in ihr Bett zurück und im Schlaf versinken. Sie wendet sich ab, mit der Tasse oder der Wanne in der Hand, und schimpft so leise vor sich hin, dass er ihre Worte für Klagen hält, gegen seine kränkelnde Natur, gegen diese chronische Krankheit, die seit beinahe zehn Jahren seine Lungen zerfrisst und aus einem einst robusten Mann dieses schmächtige und schwachbrüstige Würstchen macht, das nur noch fürs Sanatorium taugt; dann gegen ihr eigenes Pech oder die Hartnäckigkeit eines Schicksals, gegen das sie ankämpft, sie, die bereits eine gebrechliche Mutter gepflegt und beide Elternteile begraben hat.
Während der Vater sich über die dampfende Wanne beugt, aus der er mit den Händen Wasser schöpft und zu seinem Gesicht führt, hält Éléonore sich im Hintergrund, achtet aber auf jede einzelne der Verrichtungen dieser Waschung, die Abend für Abend im Lichtkreis der Lampe in gleicher Abfolge und Geschwindigkeit ausgeführt wird. Befiehlt die Erzeugerin ihr, sich hinzusetzen, beobachtet sie aus den Augenwinkeln die Wölbung dieses Rückens, den Rosenkranz der Wirbelsäule, den seifigen, über die Haut streichenden Waschlappen, die schmerzenden Muskeln, die Gesten, mit denen er ein frisches Hemd anzieht. Von einer fragilen Grazie belebt, gleiten seine Finger die Knopfleiste entlang wie die zittrigen Beinchen von Nachtfaltern, von Totenkopfschwärmern, deren Puppen in den Kartoffelfeldern ausschlüpfen. Dann steht er auf, setzt sich an den Tisch, und während die Erzeugerin sich ebenfalls setzt, führt er seine gefalteten Hände mit fest verschränkten Fingergliedern vors Gesicht, sein Blick verschwindet hinter den Fingerrücken mit den stark hervortretenden Gelenken, den schwarzen Nägeln. Mit einer vom...