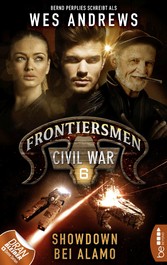Suche
Lesesoftware
Info / Kontakt
Frontiersmen: Civil War 6 - Showdown bei Alamo
von: Wes Andrews, Bernd Perplies
beBEYOND, 2018
ISBN: 9783732543663 , 157 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 2,49 EUR
eBook anfordern 
»Ein Fressen für die Geier sind wir, sonst gar nichts«, knurrte John Donovan. »Also erzählen Sie mir bloß nichts von Heldentum. Mit Heldentum hat der letzte Kampf der Konföderation gegen das Unionsmilitär hier im Alamo-System nichts zu tun. Nicht bei diesem Kräfteverhältnis.«
»Ich fürchte, dass ich Captain Donovan, so blumig seine Worte auch sein mögen, zustimmen muss«, sagte Ann-Kathryn Fisher. Die Sektorgouverneurin des Concord-Sektors saß ihm gegenüber an dem großen Konferenztisch und hatte die Hände auf der Oberfläche aus poliertem Holz gefaltet. »Nun, da die Mission der Mary-Jane Wellington zu den Reservatswelten gescheitert ist, sind uns die Streitkräfte der Kernwelten-Union unseren Geheimdienstberichten zufolge wenigstens zwei zu eins überlegen. Dazu kommt, dass unsere bunte Freiwilligenarmee militärischer Flottendisziplin gegenübersteht. Wir brauchen außergewöhnliche Ideen. Andernfalls sollten wir uns mit dem Gedanken anfreunden, zu kapitulieren, sobald die Unionskreuzer im Chambless-Transitfeld auftauchen.«
Sie saßen in einem der Besprechungsräume des provisorischen Konföderationsrats, der sich in Hattiesbay auf Ariana, dem zweiten Planeten des Alamo-Systems eingerichtet hatte. John und seine Mannschaft, die seit Sekoyas Abschied nur noch aus Hobie, Kelly, Aleandro und Piccoli bestand, hatten soeben den Abschlussbericht über ihre Reise ins Nacodoa-System und zu den dort lebenden Peko abgeliefert, tatkräftig unterstützt von Benjamin West, dem jungen und idealistischen Gouverneur des Tucson-Systems, der sie als Diplomat der Konföderation zu den grünhäutigen Nichtmenschen begleitet hatte. Die Reise war alles andere als gut verlaufen. Sie waren dem fanatischen Peko-Anführer Geonoj begegnet, der viele der Stämme auf Tonomai zum Krieg gegen die Menschen aufzuwiegeln versucht hatte. Durch Geonojs Hand wären sie beinahe ums Leben gekommen. Und selbst nachdem es Sekoya und John gelungen war, den rachsüchtigen Aufrührer unschädlich zu machen, war keineswegs alles gut gewesen. Die Tonomai-Peko waren innerlich zerrissen, verunsichert und nicht bereit für irgendwelche Bündnisverträge mit der Konföderation. Diese würde ihren Kampf allein ausfechten müssen.
Dass sie damit einer schier unmöglichen Aufgabe gegenüberstand, schien auch den übrigen Anwesenden – im Wesentlichen Gouverneure und hohe Militärs – aufzugehen. Allein Sektorgouverneur Earl Jennings wirkte noch von unerschütterlichem Kampfgeist erfüllt. Der grauhaarige Mann, der dem Oklahoma-Sektor vorstand und damals vor vier Monaten auf Purcell die Unabhängigkeit der Randplaneten verkündet hatte, stemmte die Fäuste auf den Tisch. »Wir kapitulieren erst, wenn der Feind mit seinen Schiffen den Himmel über Hattiesbay verdunkelt. So viele von uns haben bereits ihr Leben für unseren großen Traum verloren. Ich werde nicht zulassen, dass ihr Andenken besudelt wird, indem wir feige vor dem Feind den Schwanz einziehen.«
»Manchmal erfordert es mehr Mut, sich eine Niederlage einzugestehen«, murmelte Kelly.
»Wie war das?«
»Ach nichts. Nur etwas, das mein Vater früher zu mir und meinem Bruder gesagt hat.«
Auf Jennings Stirn entstand eine steile Falte, als er die Augenbrauen zusammenzog. »Ich kenne Ihren Vater nicht, Miss, aber ich bin nicht der Mann, der einen Kampf leicht verloren gibt und ihn sich danach schönzureden versucht.«
»Mein Vater –«, setzte Kelly unwirsch an, aber John hob beschwichtigend eine Hand.
»Lass es gut sein, Kelly. Das ist kein günstiger Zeitpunkt.«
»Wir sollten uns wirklich nicht streiten«, pflichtete ihm Fisher bei und warf Jennings einen mahnenden Seitenblick zu. »Es warten genug Probleme dort draußen auf uns.«
»In der Tat«, erwiderte der Sektorgouverneur. »Eins liegt darin, dass wir Ariana und das Alamo-System nicht einfach aufgeben können. Wir haben diese Welt, dieses Zentrum der Zivilisation inmitten der Randplaneten absichtlich erwählt, um hier unsere Regierung aufzubauen, Sie erinnern sich vielleicht.« Dabei sah er vor allem Kelly an. »Wir wollten damit zeigen, dass wir mehr sind als nur eine Bande Rebellen, die von einem aufgegebenen Goldgräberstollen aus den Widerstand gegen die Staatsgewalt probt.« Jennings schlug mit der Faust auf den Tisch. »Wir sind die rechtmäßigen Herren über die Welten der Konföderation. Aber wenn das Alamo-System, dieses Symbol, fällt, dann steht in den Sternen, ob wir uns von diesem Schlag jemals wieder erholen.«
»Ich denke, dass wir uns einig sind, nicht voreilig die Waffen zu strecken«, sagte West. »Also lasst uns nach vorne blicken. Welche Optionen haben wir noch, nachdem die Peko außen vor bleiben?«
»Was ist mit dieser Waffenfabrik im Juno-System?«, mischte sich Hobie ein. »Deren Belegschaft wir nach Trenton gebracht haben.«
»Sternmetall-Armstrong.« Fisher nickte.
»Genau, könnten wir da nicht unsere Bestände an Kriegsgerät noch einmal aufstocken? Immerhin liegt das Juno-System direkt nebenan.«
»Die Fabrik wurde stillgelegt«, schaltete sich Sektorgouverneur Robin De Clerk ein, der dem Jalisco-Sektor vorstand, zu dem sowohl das Juno- als auch das Alamo-System gehörte. »Nach dem Aufstand der Arbeiter und dem Diebstahl von vierzig Frachtern war an einen schnellen Weiterbetrieb ohnehin nicht mehr zu denken. Kurz darauf hat der Vorstand aufgrund der politischen Lage beschlossen, sich ganz aus den Randwelten zurückzuziehen. Wir waren nicht in der Lage, sie davon abzuhalten, den Großteil der verbliebenen Ausrüstung abzutransportieren und die Fertigungsstätten unbrauchbar zu machen. Sie haben nicht alles zerstören können. Einige der Waffensysteme und Jagdmaschinen, die gegenwärtig das Alamo-System beschützen, stammen von dort. Aber die Ausbeute war gering.«
»Zu schade«, brummte Johns alter Freund.
John schüttelte langsam den Kopf. »Das wird keine Schlacht. Das wird ein Gemetzel.«
»Ganz wehrlos sind wir nicht«, entgegnete Fisher. »Wir haben zwar gegenwärtig zu wenig Schiffe, um die Unionsflotte besiegen zu können, allerdings erwarten wir noch heute eine große Lieferung an Raumminen, die eines unserer Spezialteams während eines Überführungsflugs von den Modena-Waffenfabriken abgefangen hat. Mit diesen können wir das Chambless-Transitfeld nicht vollständig sperren, aber doch genug Hindernisse auslegen, dass die Unionskreuzer sehr vorsichtig vorrücken müssen.«
»Jede Stunde, die wir gewinnen, ist schön und gut«, meinte West, »trotzdem zögert sie das unvermeidliche Ende bloß hinaus – und dieses Ende wird kommen, wenn uns keine sehr gute Idee einfällt.«
»Wie wäre es mit einem sektorweiten Aufruf an die Zivilbevölkerung?«, schlug Piccoli vor. »Viele … Privatunternehmer besitzen mehr oder weniger gut bewaffnete Schiffe, um sich gegen Raumpiraten und Peko verteidigen zu können.«
»Unser Kampf im Rand wurde vom ersten Tag an von freiwilligen Zivilisten getragen«, sagte Fisher. »Der Großteil unserer Streitkräfte rekrutiert sich letzten Endes aus planetaren Milizen und unabhängigen Frontiersmen wie Ihnen. Allerdings ist die Kampfbereitschaft vieler Männer und Frauen gerade dieser letzten Gruppe eher gering. Sie zieren sich, für die Konföderation einzustehen und unser aller Freiheit zu verteidigen. Das ist umso bedauerlicher, da viele von ihnen über Raumschiffe mit geradezu fragwürdig guter Bewaffnung verfügen.«
John ließ sich ihr Dilemma durch den Kopf gehen. An Fishers Worten war durchaus etwas dran. Abgesehen von T. S. Sebastian waren ihm auf Haven und auch sonst in den letzten Wochen kaum bekannte Gesichter aus den Reihen der Frontiersmen über den Weg gelaufen. Im Grunde wunderte das John nicht. Gerade freischaffende Raumfahrer liebten ihre Unabhängigkeit und ihre Haut so sehr, dass sie sich äußerst ungern in die Probleme anderer Leute hineinziehen ließen. Noch vor zwei Jahren hätte John es wohl ähnlich gehalten. Einzig seine schrecklich idealistische Besatzung – Kelly, Piccoli und Aleandro im Speziellen – hatte ihn dazu bewogen, sich auf die Seite der Konföderation zu schlagen. Natürlich war es auch kein Schaden gewesen, dass Frank Langdon sie angeheuert hatte, ein Mann, auf den John nichts kommen ließ. Das mochte ein Punkt sein, an dem man ansetzen konnte.
»Vielleicht sollten Sie noch mal um Hilfe bitten«, sagte John nachdenklich zu Fisher. »Aber diesmal sollte kein Politiker mit den Leuten reden, sondern jemand, den sie kennen und dem sie zuhören, wenn er sich an sie wendet.«
Die Sektorgouverneurin sah ihn interessiert an. »Soll das heißen, Sie bieten sich als Botschafter an?«
»Meine Leute und ich sind zu den Peko geflogen, um sie zu überreden, an der Seite der Konföderation zu kämpfen. Das hier wird im Vergleich dazu ein Spaziergang.«
»Ihre Mission nach Tonomai war ein Fehlschlag«, erinnerte ihn ein weißbärtiger General, dessen Name John direkt nach der Vorstellungsrunde vergessen hatte.
»Die Grünhäute sind auch nicht unbedingt die Freunde von uns Menschen«, gab John leicht gereizt zurück. »Aber die Männer und Frauen, die Sie jetzt um Hilfe ersuchen wollen, gehören sozusagen zu unserer Familie.« Er fuhr sich übers unrasierte Kinn. »Ich kann natürlich nicht versprechen, dass alle bereit sind, ihren Hals einfach so zu riskieren. Genau genommen ist es eher unwahrscheinlich, dass mir mehr als eine Handvoll aus reiner Freundschaft oder neu entdecktem Patriotismus folgen. Also, was wollen Sie den Frontiersmen bieten?«
Die Politiker und Militärs wechselten stumme Blicke.
»Was sollten wir ihnen denn Ihrer Meinung nach bieten?«, fragte Fisher.
»Geld ist immer ein guter Anfang«, sagte John. »Und besser eine gute Stange Geld, denn der Job ist ein echtes...