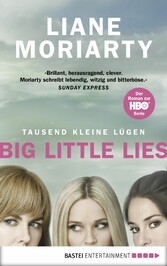Suche
Lesesoftware
Info / Kontakt
Tausend kleine Lügen - Roman
von: Liane Moriarty
Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, 2016
ISBN: 9783732514786 , 400 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 9,99 EUR
eBook anfordern 
1
»Das hört sich drüben bei der Schule aber gar nicht nach einem Quizabend an«, sagte Mrs. Patty Ponder zu Marie Antoinette. »Das klingt eher nach einer Prügelei.«
Die Katze antwortete nicht. Sie döste auf dem Sofa, weil ihr Quizabende völlig gleichgültig waren.
»Das interessiert dich wohl nicht, hm? Es ist dir völlig egal, was? Sollen sie doch Kuchen essen! Ist es das, was du denkst? Sie essen wirklich eine Menge Kuchen, nicht wahr? Diese ganzen Kuchenstände! Du meine Güte! Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass eine von den Müttern tatsächlich Kuchen isst. Sie sind alle so rank und schlank, findest du nicht? Genau wie du.«
Marie Antoinette quittierte das Kompliment mit einem höhnischen Grinsen. Diese »Sollen-sie-doch-Kuchen-essen«-Geschichte hatte einen ziemlichen Bart, und sie hatte kürzlich erst eines von Mrs. Ponders Enkelkindern sagen hören, dass es eigentlich heißen müsste: »Sollen sie doch Brioche essen!«, und dass die historische Marie Antoinette es vor allem nie gesagt hatte.
Mrs. Ponder griff nach der Fernbedienung und stellte den Ton von Dancing with the Stars leiser. Sie hatte die Lautstärke fast voll aufgedreht gehabt, um das Rauschen des sintflutartigen Regens zu übertönen, aber der hatte jetzt nachgelassen.
Sie konnte laute Stimmen hören. Aufgebrachtes Geschrei dröhnte durch die stille, kalte Nacht. Es tat Mrs. Ponder weh, als wäre die Wut gegen sie gerichtet. (Mrs. Ponder war mit einer zornigen Mutter aufgewachsen.)
»Du meine Güte! Glaubst du, sie haben sich wegen der Hauptstadt von Guatemala in die Wolle gekriegt? Weißt du, wie die Hauptstadt von Guatemala heißt? Nein? Ich auch nicht. Das sollten wir mal googeln. Sieh mich nicht so verächtlich an!«
Marie Antoinette rümpfte die Nase.
»Schauen wir mal, was da los ist«, sagte Mrs. Ponder energisch.
Sie war nervös, deshalb gab sie sich vor der Katze betont resolut, so wie früher vor ihren Kindern, wenn ihr Mann nicht da gewesen war und sie nachts seltsame Geräusche aufgeschreckt hatten.
Mrs. Ponder stemmte sich mithilfe ihres Gehgestells aus dem Sessel hoch. Marie Antoinette (die nicht auf das selbstbewusste Gehabe hereinfiel) schlüpfte mit ihrem geschmeidigen Körper zwischen Mrs. Ponders Beine, als sie ihr Gehgestell durch den Flur zum rückwärtigen Teil des Hauses schob.
Von ihrem Nähzimmer aus konnte man direkt auf den Hof der Pirriwee-Schule blicken.
»Spinnst du, Mum? Du kannst doch nicht so nahe an einer Grundschule wohnen«, hatte ihre Tochter gesagt, als Mrs. Ponder davon sprach, das Haus kaufen zu wollen.
Sie aber liebte es, den ganzen Tag immer wieder das wilde Geplapper von Kindern zu hören, und da sie nicht mehr Auto fuhr, störte es sie nicht im Geringsten, dass die Straße mit diesen riesigen Autos verstopft war, die ein bisschen wie Lastwagen aussahen und die heutzutage anscheinend alle fuhren. Die Frauen hinter dem Lenkrad trugen große Sonnenbrillen und beugten sich aus dem Fenster und riefen einander schrecklich wichtige Informationen über Harriettes Ballettstunden und Charlies Sprachtherapie zu.
Die Mütter nahmen das Muttersein in der heutigen Zeit so furchtbar ernst. Ihre angespannten Gesichter. Ihre geschäftigen kleinen Hinterteile, die sie in knackiger Sportkleidung in die Schule trugen. Ihre wippenden Pferdeschwänze. Ihr Blick, der starr auf das Handy gerichtet war, das sie vor sich hertrugen wie einen Kompass. Mrs. Ponder konnte nur darüber lachen. Aber es war ein liebevolles Lachen. Ihre drei Töchter waren ja genauso. Und wie hübsch sie alle waren!
»Wie geht’s denn so heute Morgen?«, rief Mrs. Ponder den Müttern jedes Mal zu, wenn sie mit einer Tasse Tee auf der Veranda saß oder sich im Garten aufhielt, um zu gießen.
»Wir sind furchtbar in Eile, Mrs. Ponder! So viel zu tun!«, riefen sie zurück, ohne innezuhalten, während sie ihre Kinder am Arm hinter sich herzogen. Sie waren nett und freundlich und nur eine Spur herablassend, weil sie ja nichts dafürkonnten. Sie war eben so schrecklich alt! Und sie hatten eben so schrecklich viel zu tun!
Die Väter, von denen immer mehr den Gang zur Schule übernahmen, waren ganz anders. Sie hatten es fast nie eilig, sondern schlenderten betont lässig vorbei. Keine große Sache. Alles unter Kontrolle. Das war die Botschaft. Mrs. Ponder lachte genauso gutmütig über sie wie über die Mütter.
Aber jetzt hörte es sich an, als würden sich die Eltern der Pirriwee-Schule gehörig danebenbenehmen. Mrs. Ponder schob die Spitzengardine zurück. Sie hatte seit Kurzem ein Schutzgitter vor dem Fenster. Die Schule hatte es bezahlt, nachdem ein Kricketball durch die Scheibe geflogen war und um ein Haar Marie Antoinette k. o. geschlagen hätte. (Ein paar Jungs aus der dritten Klasse hatten ihr eine handbemalte Karte mit einer Entschuldigung überreicht, die jetzt aufgeklappt auf dem Kühlschrank stand.)
Das mehrstöckige Sandsteingebäude auf der anderen Seite des Hofs verfügte über einen Veranstaltungssaal im oberen Stock und einen großen Balkon mit Blick aufs Meer. Mrs. Ponder war einige Male dort gewesen, um eine Veranstaltung zu besuchen: einen Vortrag eines hiesigen Historikers, ein Essen, zu dem der Verein »Freunde der Bibliothek« geladen hatte. Es war ein wunderschöner Saal. Manchmal gaben ehemalige Schüler dort ihren Hochzeitsempfang. Sicher fand auch der Quizabend dort statt. Von den an diesem Abend eingenommenen Spenden sollten Smartboards gekauft werden, was auch immer das sein mochte. Mrs. Ponder konnte sich unter »schlauen Tafeln« nichts vorstellen.
Sie war übrigens auch eingeladen worden. Obwohl nie eines ihrer Kinder oder Enkelkinder die Pirriwee-Schule besucht hatte, hatte ihre unmittelbare Nachbarschaft zur Schule ihr so etwas wie einen Promi-Status verliehen. Sie hatte die Einladung dankend abgelehnt. Was machte es für einen Sinn, eine Schulveranstaltung zu besuchen, wenn man keine Kinder an der betreffenden Schule hatte?
Die wöchentliche Schulversammlung wurde ebenfalls im Veranstaltungssaal abgehalten. Jeden Freitagmorgen richtete sich Mrs. Ponder mit einer Tasse English-Breakfast-Tee und einem Ingwerplätzchen in ihrem Nähzimmer ein. Ihr kamen jedes Mal die Tränen, wenn der Gesang der Kinder aus dem zweiten Stock der Schule zu ihr herunterdrang. Nur wenn sie Kinder singen hörte, glaubte sie an Gott.
Aber was sie jetzt vernahm, war kein Kindergesang.
Derbe Kraftausdrücke fielen, eine ganze Menge sogar. Sie war nicht prüde, was das betraf (ihre älteste Tochter fluchte wie ein Bierkutscher), doch es war beunruhigend und äußerst verstörend, jemanden dieses spezielle vulgäre Wort wie wahnsinnig an einem Ort kreischen zu hören, der normalerweise von Kinderlachen und übermütigem Geschrei widerhallte.
»Habt ihr alle zu tief ins Glas geschaut?«, murmelte Mrs. Ponder vor sich hin.
Ihr regennasses Fenster befand sich auf gleicher Höhe mit dem Eingang des Schulgebäudes. Plötzlich wurden die Türen aufgestoßen, Leute strömten heraus. Die Beleuchtung rings um den gepflasterten Eingangsbereich schaltete sich ein und leuchtete die Szene aus wie eine Theaterbühne. Nebelschwaden verstärkten den Effekt noch.
Es war ein sonderbarer Anblick.
Die Eltern der Schüler der Pirriwee-Schule hatten eine er-staunliche Vorliebe für Kostümfeste. Ein gewöhnlicher Quizabend genügte ihnen nicht. Mrs. Ponder wusste von der Einladung, dass irgendein Genie auf den Gedanken gekommen war, einen »Audrey-und-Elvis-Quizabend« daraus zu machen, was bedeutete, dass die Frauen sich als Audrey Hepburn und die Männer sich als Elvis Presley verkleiden mussten. (Das war mit ein Grund, weshalb Mrs. Ponder die Einladung ausgeschlagen hatte. Kostümfeste waren ihr immer schon ein Gräuel gewesen.) Die Audrey Hepburn aus Frühstück bei Tiffany war allem Anschein nach die beliebteste Vorlage. Die Frauen trugen lange schwarze Kleider, weiße Handschuhe und Perlenketten. Die Männer hingegen hatten sich größtenteils für eine Interpretation des späten Elvis entschieden und waren in glänzenden weißen Jumpsuits erschienen, die bis zur Brust aufgeknöpft und mit Glitzersteinen besetzt waren. Die Frauen sahen bezaubernd aus, die armen Männer einfach nur lächerlich.
Mrs. Ponder beobachtete, wie ein Elvis einem anderen einen Kinnhaken verpasste. Der Geschlagene taumelte rückwärts und rempelte eine Audrey an. Zwei Elvisse packten ihn von hinten und zerrten ihn weg. Eine Audrey schlug die Hände vors Gesicht und wandte sich ab, als könnte sie nicht mehr hinsehen. Jemand rief: »Aufhören! Hört endlich auf!«
Ganz recht. Was würden eure wunderschönen Kinder denken, wenn sie euch so sähen?
»Ob ich die Polizei rufen soll?«, überlegte Mrs. Ponder laut.
Doch dann hörte sie schon das Heulen einer Polizeisirene in der Ferne. Im gleichen Augenblick begann eine Frau auf dem Balkon wie von Sinnen zu kreischen.
*
Gabrielle: Es waren ja nicht bloß die Mütter, wissen Sie. Ohne die Väter wäre das alles nicht passiert. Es hat mit den Müttern angefangen. Wir waren sozusagen die Schlüsselfiguren. Wir Mummys. Ich hasse dieses Wort. Es ist so altbacken, finden Sie nicht auch? Mom ist besser. So wie die Amerikaner sagen. Das klingt dünner. Ich habe eine Körperbildstörung, wissen Sie. Aber wer hat die nicht?
Bonnie: Es war alles ein schreckliches Missverständnis. Gefühle wurden verletzt, und dann gerieten die Dinge immer mehr außer Kontrolle. Wie das eben so passiert. Jeder Konflikt geht letztendlich auf verletzte Gefühle zurück, sehen Sie das nicht auch so? Scheidungen. Weltkriege. Prozesse. Na ja, vielleicht nicht jeder Prozess. Darf ich Ihnen einen Kräutertee anbieten?
Stu: Ich kann Ihnen...