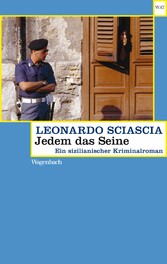Suche
Lesesoftware
Info / Kontakt
Jedem das Seine - Ein sizilianischer Kriminalroman
von: Leonardo Sciascia
Verlag Klaus Wagenbach, 2014
ISBN: 9783803141743 , 144 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 8,99 EUR
eBook anfordern 
I
Der Brief kam mit der Nachmittagspost. Als erstes legte der Briefträger wie üblich den vielfarbigen Packen der Werbeprospekte auf den Ladentisch, dann den Brief, so vorsichtig, als wäre zu befürchten, daß er explodierte: ein gelber Umschlag, auf den ein weißes Rechteck mit der aufgedruckten Adresse geklebt war.
»Der Brief gefällt mir nicht«, sagte der Postbote.
Der Apotheker sah von seiner Zeitung auf, nahm die Brille ab und fragte gereizt und neugierig zugleich: »Was ist los?«
»Ich sage, daß mir der Brief da nicht gefällt.« Mit dem Zeigefinger schob er ihn langsam über die Marmorplatte auf dem Ladentisch.
Ohne ihn zu berühren, beugte sich der Apotheker vor und betrachtete ihn. Dann richtete er sich auf, setzte die Brille wieder auf und schaute ihn noch einmal gründlich an.
»Warum gefällt er dir nicht?«
»Der ist heute nacht oder heute früh hier eingeworfen worden, und als Adresse ist ein ausgeschnittener Briefkopf der Apotheke draufgeklebt.«
»Stimmt«, bestätigte der Apotheker und starrte den Briefträger verlegen und beunruhigt an, als erwarte er von ihm eine Erklärung oder eine Entscheidung.
»Das ist ein anonymer Brief«, sagte der Briefträger.
»Ein anonymer Brief«, echote der Apotheker. Noch hatte er ihn nicht angefaßt, und schon ließ dieser Brief sein häusliches Leben aus den Fugen geraten, fuhr wie ein tödlicher Blitz auf eine nicht gerade hübsche, ein wenig verblühte, ein wenig nachlässige Frau nieder, die in der Küche gerade ein Zicklein zubereitete, um es für das Abendessen in den Ofen zu schieben.
»Die Unsitte der anonymen Briefe ist hier weit verbreitet«, sagte der Briefträger. Er hatte seine Tasche auf einen Stuhl gestellt und sich an den Ladentisch gelehnt. Er wartete darauf, daß der Apotheker sich entschloß, den Brief zu öffnen. Im Vertrauen auf das offenherzige, arglose Wesen des Empfängers hatte er ihn unangetastet abgeliefert, ohne ihn zuvor (selbstverständlich mit aller gebotenen Vorsicht) zu öffnen. Wenn er ihn aufmacht, und es handelt sich um einen Seitensprung seiner Frau, erfahre ich nichts. Ist es aber eine Drohung oder dergleichen, dann zeigt er ihn mir. Jedenfalls wollte er nicht fortgehen, ohne Bescheid zu wissen. Zeit hatte er ja.
»Mir einen anonymen Brief?« sagte der Apotheker nach langem Schweigen verwundert und empört, machte aber ein erschrockenes Gesicht. Bleich, mit verstörtem Blick, Schweißtropfen auf der Oberlippe. Und bei all seiner bebenden Neugier teilte der Briefträger diese Verwunderung und Empörung. Ein rechtschaffener Mann, umgänglich und gutmütig; einer, der in seiner Apotheke jedermann Kredit einräumte und bei den Bauern auf dem Land, das seine Frau in die Ehe mitgebracht hatte, fünf gerade sein ließ. Auch böses Gerede über die Apothekersfrau war dem Briefträger nie zu Ohren gekommen.
Plötzlich gab sich der Apotheker einen Ruck. Er nahm den Brief, öffnete ihn und entfaltete das Blatt. Der Briefträger sah, was er erwartet hatte: Der Brief bestand aus Wörtern, die aus einer Zeitung ausgeschnitten worden waren.
Der Apotheker leerte den bitteren Kelch auf einen Zug. Zwei Zeilen, nicht mehr. »Hör dir das mal an«, sagte er, aber erleichtert, fast belustigt. Der Briefträger dachte: Also kein Seitensprung. Er fragte: »Und was ist’s, eine Drohung?«
»Eine Drohung«, bestätigte der Apotheker. Er reichte ihm das Blatt. Der Briefträger griff begierig danach und las laut: »Dieser Brief ist Dein Todesurteil, für das, was Du getan hast, mußt Du sterben.« Er faltete es zusammen und legte es auf den Ladentisch. »Ein Scherz«, sagte er, und das meinte er wirklich.
»Glaubst du, daß es ein Scherz ist?« fragte der Apotheker ein bißchen beklommen.
»Was soll es denn sonst sein? Ein Scherz. Es gibt Leute, die juckt das Fell, und dann machen sie solche Scherze. Das wäre nicht das erste Mal. Auch am Telefon.«
»Stimmt«, sagte der Apotheker, »das habe ich auch schon erlebt. Nachts läutet das Telefon, ich nehme den Hörer ab, und eine Frau fragt, ob mir ein Hund entlaufen sei, sie habe einen gefunden, halb blau und halb rosa, und man habe ihr gesagt, der gehöre mir. Späße. Aber das hier ist eine Todesdrohung.«
»Das ist doch dasselbe«, erklärte der Briefträger fachmännisch, nahm die Tasche und schickte sich an zu gehen. »Machen Sie sich bloß keine Gedanken deswegen«, sagte er zum Abschied.
»Ich mache mir keine Gedanken«, sagte der Apotheker, und schon war der Briefträger draußen. Aber er machte sich Gedanken. Dafür, daß es nur ein Scherz sein sollte, ging das doch recht weit. Wenn es überhaupt ein Scherz war … Aber was konnte es sonst sein? Streitigkeiten hatte er nie gehabt, um Politik kümmerte er sich nicht, ja er diskutierte nicht einmal darüber, und wem er bei den Wahlen seine Stimme gab, wußte wirklich niemand: bei den Parlamentswahlen den Sozialisten, aus Familientradition und in Erinnerung an seine Jugend; bei den Gemeindewahlen den Christdemokraten, aus Heimatliebe, weil eine christdemokratische Gemeindeverwaltung bei der Regierung etwas für den Ort herausschlagen konnte und um jene Einkommensteuer zu verhindern, mit der die Linksparteien drohten. Nie hatte es Diskussionen darüber gegeben: Wer rechts stand, der hielt ihn für einen Mann der Rechten, und wer links stand, für einen Linken. Sich mit Politik abzugeben war im übrigen verlorene Zeit. Wer das nicht einsah, der hatte entweder seinen Vorteil davon oder war mit Blindheit geschlagen. Der Apotheker jedenfalls lebte in Frieden. Und vielleicht war das auch der eigentliche Grund für den anonymen Brief. Ein so friedliebender Mensch mußte ja Leute, deren Lebenselement Haß und Bosheit war, auf den Gedanken bringen, ihn zu beunruhigen und zu erschrecken. Oder sollte man vielleicht den Grund in seiner einzigen Leidenschaft suchen, der Jagd? Jäger sind bekanntlich Neidhammel; du brauchst nur ein gutes Frettchen zu haben oder einen guten Hund, und schon hassen dich alle Jäger im Ort, auch deine Freunde, die mit dir auf die Jagd gehen und jeden Abend zu einem Plausch in die Apotheke kommen. Daß Jagdhunde vergiftet wurden, war im Ort keine Seltenheit. Wer einen guten Hund besaß und es wagte, ihn abends auf der Piazza frei laufen zu lassen, mußte damit rechnen, daß er sich bald unter der Wirkung des Strychnins in Krämpfen wand. Und wer weiß, ob nicht der eine oder andere das Strychnin mit der Apotheke in Zusammenhang brachte. Zu Unrecht natürlich, zu Unrecht, denn für den Apotheker Manno war ein Hund heilig wie ein Gott, vor allem ein wirklich guter Jagdhund, ob es sich dabei um den eigenen oder um einen seiner Freunde handelte. Seine Hunde waren im übrigen sicher vor Gift. Er besaß elf, die meisten von einer aus der Kyrenaika stammenden Rasse, gutgenährt, wie Menschen behandelt, und der Garten hinter dem Haus stand ihnen für ihre Bedürfnisse und als Auslauf zur Verfügung. Es war ein Vergnügen, sie zu sehen und zu hören. Ihr Gebell, über das die Nachbarn zuweilen schimpften, war Musik in den Ohren des Apothekers. Er erkannte jeden an der Stimme und hörte, ob er vergnügt, ob mißgelaunt oder gar krank war.
Ja gewiß, einen anderen Grund gab es nicht. Also ein Scherz, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Jemand wollte ihm Angst einjagen, damit er am Mittwoch, an seinem freien Tag, nicht auf die Jagd ginge. Denn ohne unbescheiden zu sein: Mit seinen guten Hunden und dank seiner Treffsicherheit verursachte er jeden Mittwoch ein wahres Massensterben unter den Hasen und Kaninchen. Dr. Roscio, sein ständiger Begleiter, konnte das bezeugen. Auch er war ein guter Schütze, auch er besaß ein paar gute Hunde, aber alles in allem … So schmeichelte der anonyme Brief schließlich seiner Eitelkeit und bestätigte seinen Ruf als Jäger. Die Eröffnung der Jagdsaison stand nämlich unmittelbar bevor, und offenbar wollte man ihn davon fernhalten, obwohl dieser Tag für den Apotheker, mochte er nun auf einen Mittwoch fallen oder nicht, der schönste im ganzen Jahr war.
Über diese nun unzweifelhafte Absicht des Briefes und über die Person des Schreibers grübelnd, brachte der Apotheker einen Korbsessel hinaus und setzte sich in den Schatten, den das Haus zu dieser Stunde warf. Ihm gegenüber stand das Bronzedenkmal von Mercuzio Spanò, dem »Lehrer des Rechts und mehrmaligen Staatssekretär für das Postwesen«. Und in dieser zweifachen Eigenschaft schien der lange Schatten des Juristen im grellen Abendlicht gedankenschwer von Betrachtungen über anonyme Briefe. Belustigt sah der Apotheker zu ihm auf. Aber seine Munterkeit verkehrte sich alsbald in die Bitternis dessen, der, von Unrecht heimgesucht, entdeckt, wie hoch die eigene Menschlichkeit über die Bosheit anderer erhaben ist, und der mit sich hadert und es beklagt, daß...