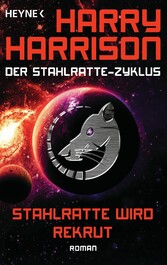Suche
Lesesoftware
Info / Kontakt
Stahlratte wird Rekrut - Der Stahlratte-Zyklus - Band 2 - Roman
von: Harry Harrison
Heyne, 2014
ISBN: 9783641138875
Format: ePUB
Kopierschutz: frei




Preis: 5,99 EUR
eBook anfordern 
1
Ich bin zu jung zum Sterben. Gerade achtzehn – und schon so gut wie tot. Mein Griff lockert sich, meine Finger gleiten ab, der Fahrstuhlschacht gähnt einen Kilometer tief unter mir. Ich kann nicht mehr festhalten. Ich stürze ab …
Normalerweise neige ich nicht zur Panik – hier aber war ich nahe am Ausflippen. Von Kopf bis Fuß vor Erschöpfung zitternd, wusste ich, dass mir diesmal kein Ausweg winkte …
Ich schwebte im wahrsten Sinne des Wortes in großer Gefahr, in Todesgefahr, aber diesmal war ich selbst daran schuld. Trotz der guten Ratschläge, die ich mir im Laufe der Jahre selbst gegeben habe, gar nicht zu reden von den noch besseren Tipps des Läufers – war alles vergessen gewesen. Impulsiv in den Wind geschlagen.
Vielleicht hatte ich den Tod verdient. Schon möglich, dass eine Edelstahlratte geboren worden war – doch würde ein sehr eingerostetes Exemplar dieser Gattung nun ins Gras beißen. Der metallene Türrahmen war eingefettet, und ich musste mich mit schmerzenden Fingern festklammern. Meine Zehen fanden auf dem schmalen Vorsprung kaum einen Halt, während die Hacken ungeschützt in die schwarze Leere hinausragten. Ich stand schon zu lange auf Zehenspitzen, so dass nun auch die Füße weh taten – eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem Feuer, das durch meine Unterarme züngelte.
Dabei war mir der Plan im Anfang so hübsch logisch, simpel, gut und intelligent vorgekommen.
Inzwischen aber hatte er sich als unausgegoren, zu kompliziert, mies und idiotisch erwiesen.
»Du bist ein Blödmann, Jimmy diGriz«, knurrte ich durch zusammengebissene Zähne und merkte erst jetzt, dass ich sie tief in die Unterlippe geschlagen und mich selbst blutig gebissen hatte. Ich löste die Kaumuskeln und spuckte aus – dabei rutschte meine rechte Hand ab. Die immense Angstwoge, die mich durchschoss, unterdrückte die Erschöpfung und ließ mich in einer Explosion verzweifelter Energie einen neuen Halt finden.
Das Auflodern verebbte aber so schnell, wie es gekommen war, und änderte an meiner Situation prinzipiell gar nichts. Allenfalls war ich noch müder als vorher. Es gab keine Rettung. Ich saß hier fest, bis ich mich nicht mehr festhalten konnte, bis meine Hand sich öffnete und ich in die Tiefe stürzte. Da war es vielleicht am besten, das Unvermeidliche gleich hinter mich zu bringen …
»Nein, Jim, keine Kapitulation!«
Die Stimme klang durch das Pochen des Blutes in meinen Ohren und schien aus weiter Ferne zu kommen; sie klang tiefer als sonst und hörte sich an, als spräche der Läufer zu mir. Der Gedanke war typisch für ihn, warum sollte es nicht die Stimme des Läufers sein? Ich ließ nicht los, doch wusste ich nicht mehr, warum ich noch durchhielt. Überdies beunruhigte mich ein fernes Jaulen.
Ein Jaulen? Der Fahrstuhlschacht war schwarz wie ein Grab und ebenso still. War der Maglevlift wieder in Betrieb? Mit muskelverkrampfter Langsamkeit neigte ich den Kopf und schaute in die Tiefe. Nichts.
Oder doch: ein schwacher Lichtschimmer.
Der Fahrstuhl kam den Schacht herauf.
Na und? Dieses Regierungsgebäude hatte zweihundertdreiunddreißig Stockwerke. Wie gering war die Chance, dass die Kabine im Stockwerk unter mir hielt, damit ich ihr elegant aufs Dach steigen konnte? Bestimmt astronomisch gering; ich hatte wenig Lust, die Wahrscheinlichkeit genau zu errechnen. Vielleicht hatte der Lift sogar dieses Stockwerk zum Ziel und zermalmte mich im Vorbeifahren wie ein Insekt? Auch eine hübsche Vorstellung. Ich sah das Licht rasch näherkommen, dabei öffneten sich meine Pupillen in dem Maße, wie das Licht heller wurde. Das anschwellende Heulen der Hubräder, ein Lufthauch, der mich explosiv umgab, das Ende war gekommen …
Das Ende der Aufwärtsbewegung. Die Liftkabine stoppte dicht unter mir, so dicht, dass ich das Fauchen hörte, mit dem sich die Tür öffnete, und das anschließende Gespräch von zwei Wächtern.
»Ich gebe dir Deckung. Bleib feuerbereit, solange du den Saal durchsuchst.«
»Du gibst mir Deckung, vielen Dank! Ich kann mich nicht erinnern, mich als Spähtrupp gemeldet zu haben.«
»Das habe ich dir abgenommen. An meinem Ärmel kleben zwei Streifen, an deinem nur einer – das heißt, du schaust dich um.«
Einstreifen murrte und verließ denkbar langsam den Fahrstuhl. Als sein Schatten das aus der offenen Lifttür fallende Licht verdeckte, senkte ich den linken Fuß behutsam auf das Dach der Kabine. Und hoffte, dass der Abgang des Mannes jede Bewegung vertuschte, die mein Umstieg vielleicht auslöste.
Eine Kleinigkeit war das nicht. Mein Bein verkrampfte sich, meine Finger wollten keine Bewegung mehr tun. Langsam ließ ich den zitternden rechten Fuß folgen, bis ich oben auf der Liftkabine stand. Meine verkrampften Finger hatten den Türrahmen noch nicht losgelassen; ich kam mir wie ein Idiot vor.
»Flur ist leer!«, rief eine Stimme aus der Ferne.
»Lies mal den Entfernungsorter ab!«
Von draußen waren Stimmengemurmel und klappernde Geräusche zu hören, während ich die rechte Hand von dem glitschigen Metall losriss und mich beim Abstützen allein auf die widerstrebende Linke verließ.
»Ich selbst zeichne mich ab. Davon abgesehen liegt die letzte Bewegung hier im Korridor bei achtzehn Uhr. Leute, die nach Hause gehen.«
»Dann stehen wir vor einem kleinen Rätsel«, stellte Doppelstreifen fest. »Komm zurück! Nach unserer Messung ist der Lift in dieses Stockwerk gefahren. Von hier haben wir ihn nach unten geholt. Du sagst jetzt, es wäre niemand ausgestiegen. Ein Rätsel.«
»Das ist kein Rätsel, sondern eine schlichte Fehlfunktion. Ein Computerproblem. Wenn niemand an der Tastatur sitzt, gibt sich das Ding selbst was zu tun.«
»So ungern ich dir zustimme – du hast recht. Gehen wir wieder Kartenspielen!«
Einstreifen kehrte zurück, die Lifttür glitt zu, und ich ging vorsichtig in die Hocke. So fuhren wir einträchtig zusammen den Fahrstuhlschacht abwärts. Die Wächter stiegen in der Gefängnisetage aus, und ich begnügte mich damit, in der knackenden Stille zu hocken und mir mit zitternden Fingern die Knoten aus den Muskeln zu massieren. Als ich sie einigermaßen wieder unter Kontrolle hatte, öffnete ich das Luk, auf dem ich saß, sprang in die Kabine hinab und schaute vorsichtig hinaus. Die Kartenspieler saßen außer Sichtweite im Wächterzimmer, wohin sie auch gehörten. Mit unendlicher Vorsicht kehrte ich an den Ausgangspunkt meiner fehlgeschlagenen Flucht zurück: schuldbewusst-geduckt – wäre ich ein Hund gewesen, hätte ich den Schwanz eingeklemmt – schlich ich an den Wänden entlang und fummelte mit dem Dietrich an den Korridortüren herum, die ich öffnete und wieder hinter mir schloss – zuletzt meine Zellentür. Dann versteckte ich den Dietrich wieder in meiner Schuhsohle und ließ mich mit einem Seufzen aufs Bett sinken, das auf der ganzen Welt zu hören sein musste. In der Schlafstille des Zellenblocks wagte ich kein lautes Wort zu äußern, doch schrie ich sie innerhalb meines Schädels um so lauter hinaus:
»Jim, du bist der hirnrissigste Idiot, der je auf die Welt gekommen ist. Lass dir so etwas bloß nie wieder einfallen, niemals!«
Grimmig-stumm gab ich mir das Versprechen, das sich mir nun wahrlich dauerhaft in die Medulla Oblongata eingegraben hatte. Um die Wahrheit führte kein Weg herum. In meinem Eifer, aus dem Gefängnis herauszukommen, hatte ich alles falsch gemacht.
Diesem Mangel gedachte ich schnellstmöglich abzuhelfen.
Ich hatte übereilt gehandelt. Jegliche Hast war unangebracht. Nach meiner Verhaftung hatte Captain Varod, Kämpfer der Liga-Marine, keinen Zweifel daran gelassen, dass er von meinem versteckten Dietrich wusste. Doch er hatte auch angedeutet, dass er Gefängnisse nicht mochte. Obwohl er fest an Gesetz und Ordnung glaubte, war er angesichts des Aufruhrs, den ich ausgelöst hatte, nicht der Meinung, dass ich auf meinem Heimatplaneten Bisschen Himmel eingekerkert werden sollte. In diesem Punkt stimmte ich ihm natürlich zu. Da er von dem Dietrich wusste, hätte ich mir Zeit lassen sollen. Vielleicht bis zu dem Augenblick, da man mich von hier an einen anderen Ort verlegte.
Während des Transfers. Im Grunde hatte ich nur meine Zeit abreißen wollen in diesem schwerbewachten und technisch perfekt abgeschirmten Gefängnis im Zentrum des Ligagebäudes in der Mitte des Stützpunkts auf diesem Planeten, von dem ich nur den Namen wusste – Steren-Gwandra. Denn irgendwie hatte ich die Ruhe genossen – und die Mahlzeiten, die nach den kriegerischen Ereignissen und dem Fraß auf Spiovente ein wahres Vergnügen waren. Diesen Vergnügungen hätte ich mich weiter hingeben sollen, in der Hoffnung, mich für die bevorstehende Freiheit zu stärken. Ja, warum hatte ich dann doch ausbrechen wollen?
Ihretwegen, wegen einer Frau, wegen einer Erscheinung, die ich kurz erschaut und sofort wiedererkannt hatte. Ein Blick hatte genügt, mir den Verstand zu rauben, die Emotionen hatten die Oberhand gewonnen und mich zu meinem katastrophalen Fluchtversuch getrieben. Was für ein Dummkopf ich doch war! Grimmig verzog ich das Gesicht, als meine Gedanken an den Anfang des idiotischen Abenteuers zurückkehrten.
Es passierte während der nachmittäglichen Leibesertüchtigungen, die ehrlich aufregend waren, auch wenn sie sich darin erschöpften, dass die Gefangenen ihre Zellen verlassen und im weichen Licht der Doppelsonne über den Stahlbeton schlurfen durften. Ich zog die Füße nach wie alle anderen und versuchte meine Gefährten nicht weiter zu beachten. Tiefe Haaransätze, zusammengewachsene Augenbrauen, schlaffe, speichelsabbernde Lippen; eine höchst unbefriedigende Spitzengruppe von...